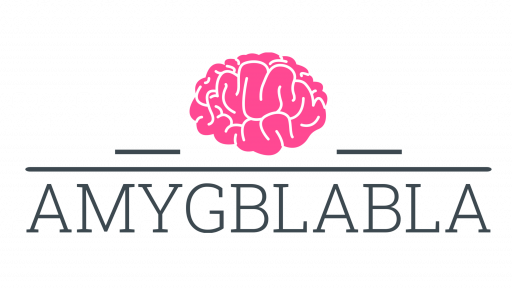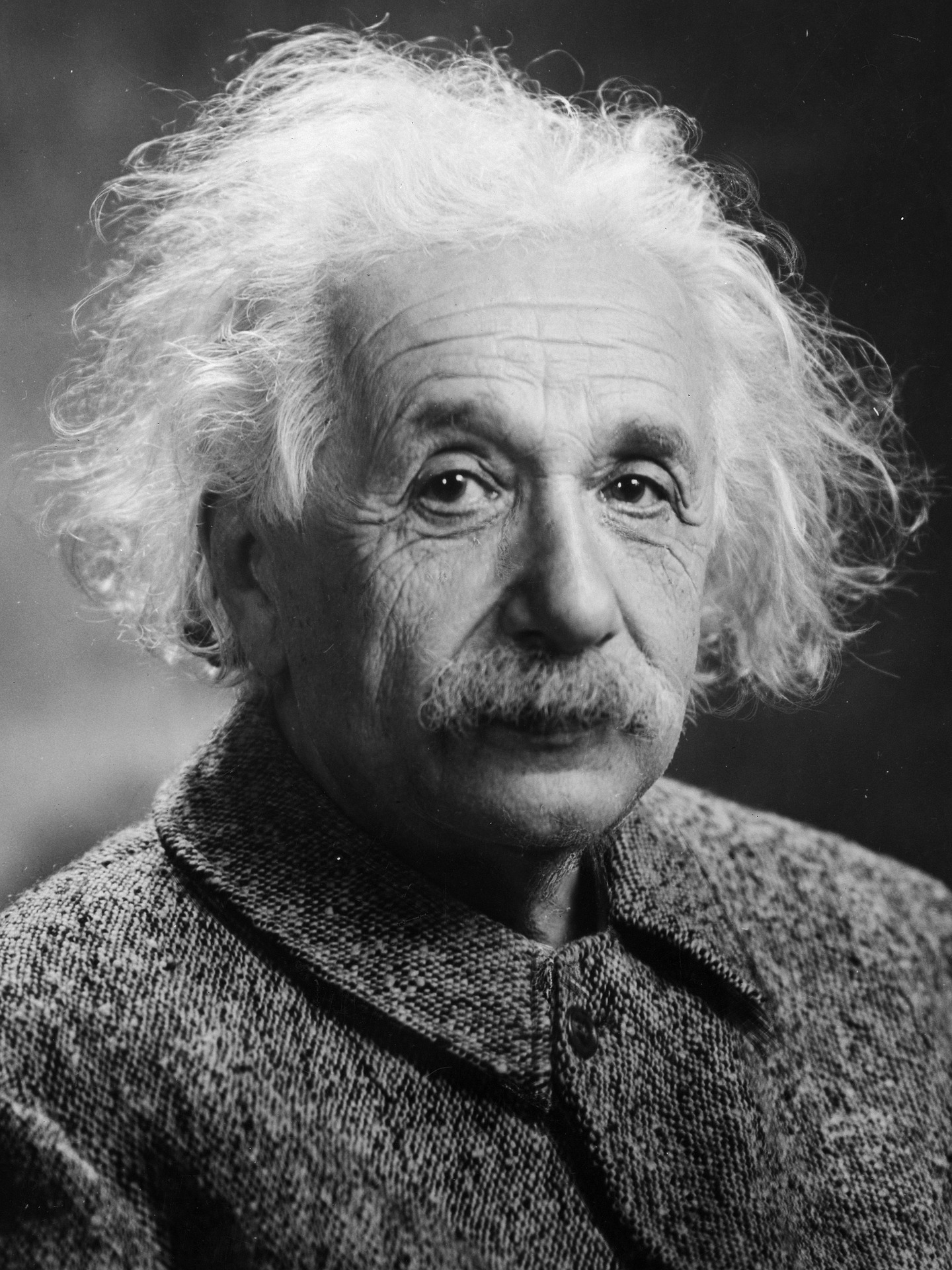Doppelmoral
Der Nachbar erzieht seinen Hund mit Elektroschockhalsband? Ein Skandal! Ein Schwein wird mit Bolzenschussgerät erschossen, dann ausgeblutet und zerstückelt, um mir hinterher als Salami serviert zu werden? Kein Problem. Ohne wirklich ersichtlichen Grund werden manche Tiere von uns brutal zugerichtet, während die Anderen den Truthahneintopf von Cesar® bekommen.
Aber trotz der Inkonsistenz bei Hunden und Schweinen folgt unser Empathievermögen mit anderen Spezies recht klaren Regeln: Große Tiere verdienen mehr Mitleid als kleine, je flauschiger, desto besser und alles, was krabbelt und schleimt, hat von vornherein verloren. Diese einschlägigen Kriterien sind so tief in uns verwurzelt, dass sie es bis in die höchsten Ebenen der Gesetzgebung geschafft haben. Während man die großen und kuscheligen Tiere betäuben muss, bevor man sie Behandlungen unterzieht oder tötet, gibt es derartige Regeln für die Kellerassel und den Blutegel nicht. [1]
Im Garten darf man freimütig Futter für die Vögel und Gift für die Schnecken auslegen. Das umgekehrte, Gift für die Vögel und Futter für die Schnecken, kann einem eine mehrjährige Gefängnisstrafe einhandeln. Eine vor Ungerechtigkeit strotzende Doppelmoral, mindestens aus Sicht der Schnecke. Das juristisch entscheidende Kriterium hier ist natürlich nicht Flauschigkeit, sondern etwas anderes: die Wirbelsäule. Spinnen, Würmer, Schmetterlinge, Seesterne und Hummer darf man in Deutschland relativ unbehelligt töten, aber sobald ein Tier Wirbel besitzt, hat es einen ganzen Katalog von Rechten. [1]
Klassentrennung im Tierschutzgesetz
Warum also hat das Rückgrat eine so entscheidende juristische Bedeutung? Grob gesagt, gibt es im Tierschutzgesetz zwei Klassen von Tieren. Die Einen haben ein farbenfrohes Innenleben; sie können Freude, Schmerz, Kummer und Stress fühlen. Sie verdienen deshalb auch besonderen Schutz, denn man möchte nicht, dass sie unnötig leiden. Die anderen soll man sich eher wie kleine Roboter vorstellen, die zwar auf ihre Umwelt reagieren können, aber selbst nichts oder nur sehr begrenzt etwas fühlen können. Deshalb brauchen sie auch nicht denselben Schutz. [2]
Die Trennlinie zwischen diesen beiden Klassen soll nach allgemeiner Auffassung ungefähr zwischen den Vertebraten und den Invertebraten verlaufen, also Tieren mit und ohne Wirbel. [2] Rein zufällig ist die Klasse, der wir ein Bewusstsein unterstellen, also voll von niedlichen Tierarten, wie Schildkrötenbabies, Koalas, Pinguinen und Delphinen. Die andere Klasse hat Vertreter wie giftige Spinnen, Würmer, Kakerlaken und Moskitos. Da fragt man sich schon, ob wir bei der Verteilung von Tierrechten wirklich unparteiisch vorgegangen sind.
Denn einen besonders guten Grund für die Annahme, dass nur manche Tiere Schmerzen empfinden können, gibt es eigentlich nicht. Es hat halt noch nie ein Regenwurm überzeugend dargelegt, dass er sich zwar erholt, wenn man ihn in zwei Teile zerlegt, aber dass die ganze Prozedur mit erheblichen Schmerzen verbunden ist. Ein Schwein schreit, wenn es Schmerzen hat, Hunde machen herzzerreißende Gesichtsausdrücke. Aber ob eine Spinne hoffnungsfroh, deprimiert oder eben schmerzverzerrt dreinblickt, können wir nur schwer beurteilen.
Der philosophische Ansatz
Aber bedeutet das, dass die Spinne wirklich nichts fühlt? Oder können wir es einfach nicht so gut erkennen? Für lange Zeit war die Frage nach der Empfindungsfähigkeit von Tieren eine für die Philosophie. Wie für Philosophen üblich, ist nach langem Überlegen, Beratungen, und Gedankenexperimenten aber dann wenig Konkretes herausgekommen. Schon bei der Definition von „Bewusstsein“ hatte man seine Schwierigkeiten. An konkrete Kriterien dafür, wer ein Bewusstsein hat und wer nicht, brauchte man gar nicht zu denken. [3]
Es kann immer sein, dass das betreffende Lebewesen zwar aussieht, als würde es leiden, aber eigentlich nichts dabei fühlt. Zum Beispiel, wenn ein Wurm bei Berührungen zusammenzuckt, kann es sein, dass er die Berührung unangenehm findet, und sich zurückziehen möchte. Es kann aber auch sein, dass das Ganze nur eine Reflexhandlung ist, die ein Roboter genauso ausführen könnte.
Eine japanische Firma hat vor ein paar Jahren genau so einen Roboter gebaut, der schreit und zuckt, wenn man ihn zu grob behandelt. Er soll beginnenden Zahnmedizinern beibringen, sanft mit ihren Patienten umzugehen. Würde man den Roboter neben einen Menschen im Behandlungszimmer legen, könnte man aus reiner Beobachtung nur schwer erkennen, wer von beiden wirklich Schmerzen empfindet.
Mit absoluter Sicherheit wissen die Philosophen eigentlich nur, dass sie selbst etwas empfinden. Ob es den Mitmenschen genauso geht, oder ob sie eigentlich nur eine Art organischer Roboter sind, kann man im Zweifelsfall nicht feststellen. Und bei Tieren weiß man es noch viel weniger.
Fühlen Hummer nichts?
In diesem Wissensvakuum hat man sich lange einfach auf das Bauchgefühl verlassen. Affen sehen uns ähnlich, ihnen sollte man kein Leid zufügen. Hummer haben ein seltsames Gesicht und schmecken gut, ist schon in Ordnung, wenn man sie lebend kocht. Das Gerücht, dass sie ihren eigenen Hitzetod gar nicht mitbekommen, hält sich noch immer hartnäckig, obwohl es eigentlich nie überzeugende Belege dafür gab. [4]
Natürlich, sie haben ein sehr viel einfacheres Nervensystem als wir und auch nicht dieselben Hirnstrukturen. Aber dass es gerade die Komplexität unseres Nervensystems ist, die es uns erlaubt, Schmerzen zu empfinden, hat noch keine Untersuchung gezeigt. Vielleicht reicht es ja auch aus, überhaupt ein Nervensystem zu haben. [5]
Kriterien für das Bewusstsein
Es ist also höchste Zeit, die Wissenschaft einmal zu Wort kommen zu lassen. In den letzten Jahrzehnten sind immer mehr Studien über die Leidensfähigkeit von „niederen“ Tieren erschienen. Wie bereits angedeutet, stehen solche Studien allerdings vor philosophischen Hürden. Glücklicherweise, haben die eher praktisch orientierten Naturwissenschaftler sich davon nicht aufhalten lassen. Sie haben eine Liste von acht Bewusstseinskriterien entwickelt, bei deren Erfüllung man „sehr starke Indizien“ dafür sieht, dass eine Spezies etwas fühlen kann. [4]
Ein Teil der Kriterien befasst sich mit dem Verhalten von Tieren bei Gefahr. Reagieren sie, wenn man sie bedroht? Und lernen sie aus schmerzhaften Erfahrungen? Um das zu untersuchen, haben Forschende ein ganzes Repertoire von folterähnlichen Methoden. Wahlweise werden den Tieren Elektroschocks gegeben, Gliedmaße zerquetscht oder sogar Körperteile Zwangs-amputiert. Das Ergebnis: Viele der untersuchten wirbellosen Tiere verhalten sich so, wie man es unter Schmerzen erwarten könnte. Krabben reiben sich die verletzte Stelle, Fliegenlarven fangen an wild zu zucken, und wenn man Spinnen Flüssigkeiten spritzt, die bei Menschen Schmerz auslösen, dann werfen sie nach kurzer Zeit das Bein ab. Auch wenn letzteres ein etwas drastischer Weg ist, die Situation zu lösen. Die meisten der wirbellosen Tiere lernen auch Orte zu vermeiden, an denen ihnen vorher Schaden zugefügt wurde. Diese Häkchen können also schon einmal gesetzt werden. [4, 6]
Eine weitere Gruppe der Bewusstseinsmerkmale dreht sich um die Effektivität von Schmerzmitteln. Fällt die Reaktion auf schädliche Reize weniger stark aus, wenn zum Beispiel Opiate verabreicht werden? Sind verletzte Tiere bereit, einen größeren Aufwand auf sich zu nehmen, um Opiatwasser, als Zuckerwasser zu trinken? Hier ist die Studienlage etwas weniger eindeutig. Bei manchen wirbellosen Arten, beispielsweise Hummern, konnte man ein solches Verhalten nachweisen, bei Bienen ist die Studienlage uneindeutig, und bei den meisten anderen hat man es einfach noch nicht untersucht. [4, 6]
Zu guter Letzt geht es noch um die neurobiologische Ausstattung. Vor allem, um das Vorhandensein von sogenannten Nozizeptoren. Das sind Sensoren, die zum Beispiel bei Hitze, starkem Druck oder Schäden im Gewebe aktiv werden. Ihr Signal wird dann über das Rückenmark bis zum Gehirn weitergeleitet und es tut uns die betreffende Körperstelle weh. Wird das Signal auf dem Weg zum Gehirn unterbrochen, wie zum Beispiel bei Menschen mit Rückenmarksverletzung, fühlt man auch keinen Schmerz. Ob eine Tierart mit diesen Rezeptoren ausgestattet ist, wird als wichtiges Kriterium für die Möglichkeit von bewusstem Schmerz gesehen. Und tatsächlich hat man vom Fadenwurm bis zur Fruchtfliege Nozizeptoren finden können. Ein weiteres Häkchen. [4, 6, 7]
Kein Tier ist mit Sicherheit schmerzfrei
Es spricht also vieles dafür, dass auch unsere Verwandten ohne Knochen im Rücken leiden, wenn sie verletzt werden. Vor allem bei Kopffüßern und Krustentieren, also zum Beispiel Tintenfische und Hummer, ist man sich inzwischen sehr sicher, dass sie empfindungsfähig sind. Sie haben deshalb ein paar Sonderrechte bekommen, aber zumindest Hummer darf man immer noch lebend kochen. [4, 8]
Bei anderen Wirbellosen ist man sich aber noch nicht so sicher. Vor allem an den Insekten scheiden sich die Geister. Anekdotische Quellen berichten, dass manche von ihnen trotz zerstörter Unterschenkel (oder biologisch korrekt: „Tarsus“) weitergehen, als wäre nichts passiert. Und auch, wenn sie gerade von einem größeren Tier aufgefressen werden, nicht aufhören, ihre eigene Mahlzeit zu verspeisen. [9] Systematische Untersuchungen dazu sind rar und auch ist nicht bekannt, wie viele der über 900 Tausend Insektenspezies dieses makabre Verhalten wirklich betrifft.
Eine kürzlich erschienene Studie, hat die bestehende Literatur zu den Sechsbeinern zusammenfassend ausgewertet. Die Autoren sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass zumindest bei Fliegen, Mücken, Kakerlaken und Termiten es recht wahrscheinlich ist, dass sie Schmerzen empfinden können. Bei ihnen sind zumindest sechs der acht Kriterien für Bewusstsein erfüllt. Bei allen anderen Insekten hat es nur für 3-4 der Kriterien gereicht. Hauptsächlich, wegen unzureichender Studienlage. Keinem der untersuchten Tiere konnte das Schmerzempfinden jedoch mit Sicherheit abgesprochen werden. [10]
Ein schwieriges Zusammenleben
Auch wenn das letzte Wort in dieser Diskussion noch nicht gesprochen ist, deutet vieles darauf hin, dass auch die achtbeinigen und schleimigen Tierarten keine gefühllosen Miniroboter sind. Die Einteilung von Tieren in zwei Klassen mit verschiedenen Rechten muss man also höchst kritisch sehen. Die Linie, entlang der diese Klassifizierung vorgenommen wird, scheint mehr nach ästhetischen, als nach wissenschaftlichen Maßstäben gewählt zu sein. Es ist aber natürlich auch alltagstauglicher, bei manchen Tieren nicht so genau hinzuschauen. Sonst dürfte man hinterher nicht mehr auf die Autobahn, wenn sich gerade ein Mückenschwarm dorthin verirrt hat. Auch müssten wir das Tragen von Seidenschals überdenken, bei deren Herstellung lebende Seidenraupen zu Tausenden in kochendes Wasser geworfen werden.
In der nächsten Zeit kann man wohl nicht auf viel strengere Gesetzgebung in diesem Bereich hoffen. Es muss jetzt jeder selbst entscheiden, wie er oder sie mit den kleinen Mitbewohnern auf unserem Planeten umgeht. Sie machen immerhin mehr als 99 % der uns bekannten Tierspezies aus. [11] Bei Schweinen und Kühen zumindest, haben wir uns noch nicht davon abbringen lassen, sie zu essen oder als Ledertaschen zu tragen
Quellen
[1] TierSchG – Tierschutzgesetz. https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
[2] Horvath, K., Angeletti, D., Nascetti, G., & Carere, C. (2013). Invertebrate welfare: an overlooked issue. DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), 49(1), 9–17. https://doi.org/10.4415/ann_13_01_04
[3] Wagner-Altendorf, T. A. (2024). Progress in understanding consciousness? easy and hard problems, and philosophical and empirical perspectives. Acta Analytica. https://doi.org/10.1007/s12136-024-00584-5
[4] Birch, J, Burn, C, Schnell, A, Browning, H & Crump, A. 2021. Review of the evidence of sentience in cephalopod molluscs and decapod crustaceans. LSE Consulting. LSE Enterprise Ltd. The London School of Economics and Political Science. https://www.lse.ac.uk/News/News-Assets/PDFs/2021/Sentience-in-Cephalopod-Molluscs-and-Decapod-Crustaceans-Final-Report-November-2021.pdf
[5] Birch, J. (2020). The search for invertebrate consciousness. Noûs/NoûS, 56(1), 133–153. https://doi.org/10.1111/nous.12351
[6] Sneddon, L. U., Elwood, R. W., Adamo, S. A., & Leach, M. C. (2014). Defining and assessing animal pain. Animal Behaviour, 97, 201–212. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2014.09.007
[7] Burrell, B. D. (2017). Comparative biology of pain: What invertebrates can tell us about how nociception works. Journal of Neurophysiology, 117(4), 1461–1473. https://doi.org/10.1152/jn.00600.2016
[8] TierSchlV – Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates. https://www.gesetze-im-internet.de/tierschlv_2013
[9] Eisemann, C. H., Jorgensen, W. K., Merritt, D. J., Rice, M. J., Cribb, B. W., Webb, P. D., & Zalucki, M. P. (1984). Do insects feel pain? — A biological view. Experientia, 40(2), 164–167. https://doi.org/10.1007/bf01963580
[10] Gibbons, M., Crump, A., Barrett, M., Sarlak, S., Birch, J., & Chittka, L. (2022). Can insects feel pain? A review of the neural and behavioural evidence. Advances in Insect Physiology, 155–229. https://doi.org/10.1016/bs.aiip.2022.10.001
[11] The welfare of invertebrate animals. (2019). In Animal welfare. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13947-6