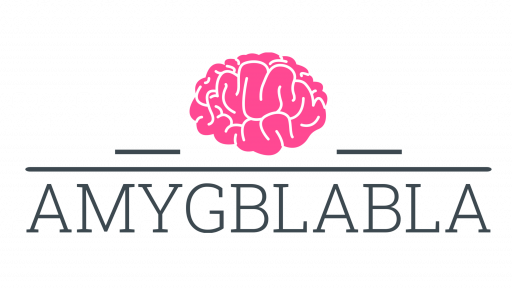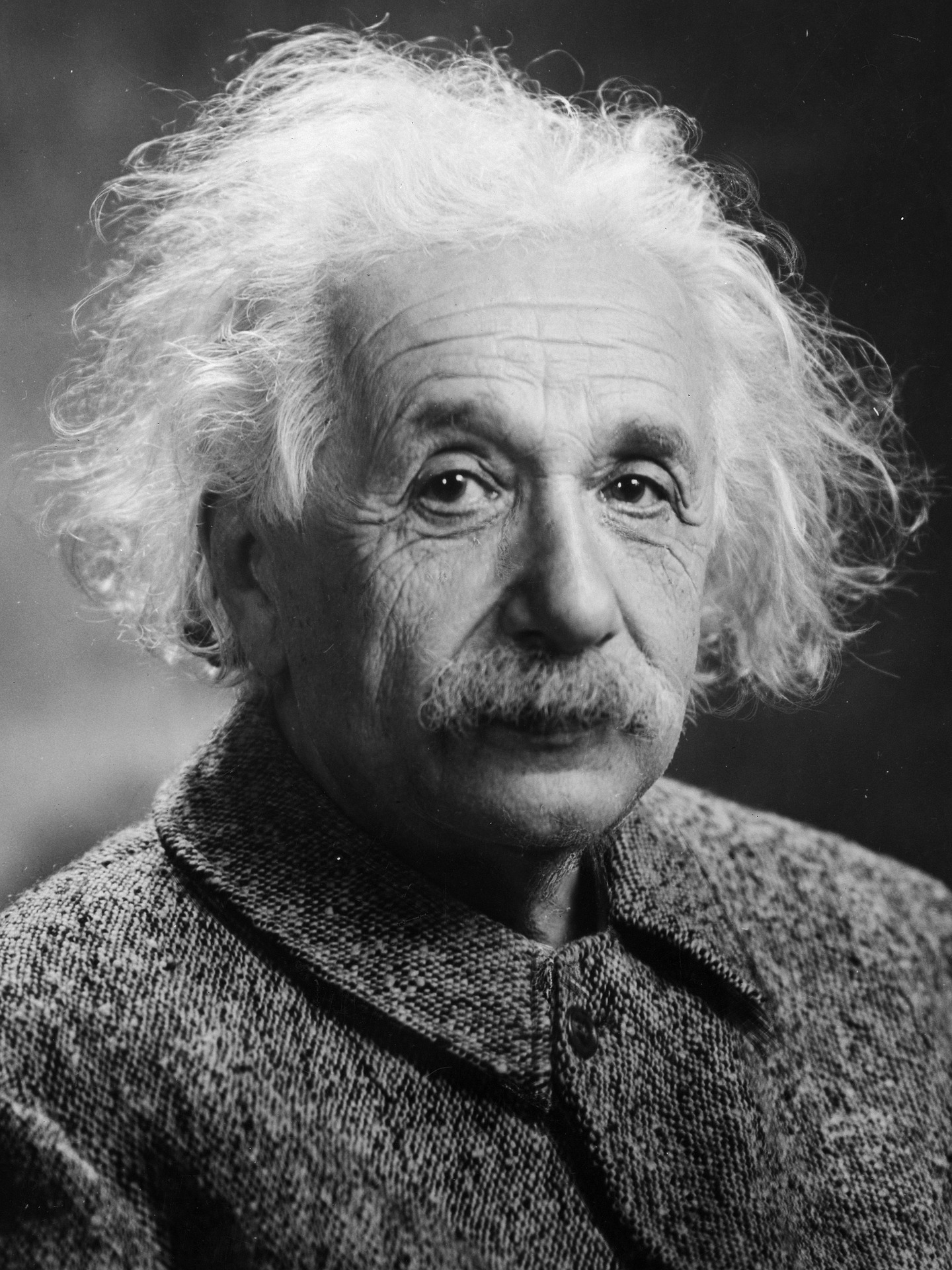Eine unwiderstehliche Gelegenheit
Was wäre eigentlich, wenn man das Gehirn von Albert Einstein hätte? Könnte man damit etwas anfangen? Würde man etwas Spannendes, vielleicht sogar etwas Revolutionäres über Intelligenz und Genie erfahren? Diese Fragen hat sich Thomas Harvey vor gut 70 Jahren gestellt, als er den frisch verstorbenen Nobelpreisträger vor sich auf dem Obduktionstisch liegen hatte. Wäre es nicht eine unerhörte Verschwendung so eine Gelegenheit der Forschung entgehen zu lassen? [1]
Große Männer mit kleinlichen Diskussionen
Als sich Thomas Harvey diese Fragen im Jahr 1955 aufdrängten, hatte das Untersuchen von Gehirnen Verstorbener bereits eine gewisse Tradition. In den letzten 100 Jahren hatten Forschende in wilden Debatten versucht, sich gegenseitig durch kleinere Gehirne zu diskreditieren. Der deutsche Wissenschaftler Emil Huschke untersuchte im Jahr 1854 die Gehirne von Deutschen und Franzosen mit dem für ihn wenig überraschenden Ergebnis: Das deutsche Gehirn ist im Schnitt gute 100 Gramm schwerer als das Französische. [2] Für den französischen Anatom Louis P. Gratiolet war dies der entscheidende Beweis, dass die Größe des Gehirns nichts mit Intelligenz zu tun hat. Sonst würden ja gerade die Deutschen nicht an der Spitze der Skala stehen.
Dies gefiel wiederum einem anderen französischen Anatomen nicht. Paul Broca war ein vehementer Verfechter der These, dass Gehirngröße und Intelligenz eng miteinander verwoben sind. Er hat unter anderem für seine Behauptung, dass sich gesellschaftliche Hierarchien an der Größe des Gehirns nachvollziehen lassen, Eingang in die Geschichtsbücher gefunden. [3] Im Laufe seines Lebens buddelte er hunderte von Leichen aus ihren Gräbern, um die vermodernden Gehirne zu untersuchen. Sein Ergebnis: Reiche haben größere als Arme, Frauen kleinere als Männer und am wenigsten behirnt sind die Unterdrückten in den Kolonialstaaten. Die These Gratiolets, dass Größe und Intelligenz nun doch nicht zusammenhängen passte ihm natürlich überhaupt nicht in den Kram. Um seine Ansichten retten zu können, startete er nun ein neues Vermessungsprojekt. Es mündete in der Feststellung, dass all die anderen Hirnforscher endlos viele Fehler gemacht haben sollen und nun doch das französische Gehirn das größte ist.[3]
Die meisten dieser Ergebnisse konnten dem Test der Zeit nicht standhalten. Weder Deutsche noch Franzosen haben die größten Gehirne, aber vor allem lässt sich dadurch keine Hierarchie zwischen Menschen begründen.[4]
Einsteins graue Zellen sehen etwas mager aus auf der Waage
Dieser ganzen Kontroverse ungeachtet entscheidet sich Thomas Harvey dazu, Einsteins Gehirn zu untersuchen. Seine Gelegenheit ist zu einzigartig, um sie sich entgehen zu lassen.
Da Einstein recht offensichtlich an einer inneren Blutung im Bauchbereich verstorben ist, wäre es im Rahmen der Autopsie eigentlich gar nicht notwendig das Gehirn zu entfernen. Aber warum nicht gründlich sein, wer weiß, was man findet? Thomas Harvey schneidet also Einsteins Schädel, nimmt das Gehirn heraus und legt es auf die Waage. Das Ergebnis ist etwas enttäuschend.[1]
Gerade einmal 1230 Gramm wiegt Einsteins Gehirn[1]. Das ist unterdurchschnittlich. Vergleicht man es mit dem Durchschnittsgewicht für Männer von ungefähr 1340 Gramm [5], lässt das den weithin verehrten Akademiker alt aussehen. War er am Ende doch nur ein überschätzter Minderbemittelter?
Mehr Gehirn macht nicht schlauer
Die Frage, ob größere Gehirne wirklich intelligenter machen, hat die Forschung schon lange kontrovers beschäftigt. Erste Ergebnisse deuteten zwar auf einen Zusammenhang hin, aber dann fand man immer wieder, dass besonders schlaue Köpfe nur recht kleine Gehirne beinhalteten. Und noch schlimmer, manche Idioten, wie man es im 19. Jahrhundert so charmant ausdrückte, konnten ein größeres Gehirn aufweisen als so mancher Mathematiker. [1]
Nun hat man aber weder Intelligenz noch Idiotie besonders gut messen können. Die betreffenden Personen waren im Regelfall schon tot, als man ihr Gehirn in den Händen hielt. Auch ließen die Messmethoden des 19. Jahrhunderts zu wünschen übrig, weshalb es immer Gründe gab Ergebnisse, die einem nicht gefielen wegzudiskutieren. So wurde für lange Zeit munter hin- und her geforscht, ohne dass irgendwer abschließend hätte sagen können, was denn nun an der Sache mit den Gehirnen dran ist. [3]
Mit dem Ende des 20. Jahrhunderts erlaubten es moderne Techniken erstmals, im lebenden Menschen die Größe des Gehirns präzise zu messen. Forschende fanden so heraus, dass größere Gehirne im Schnitt tatsächlich öfter zu intelligenteren Menschen gehören [6]. Genau wie mit anderen Durchschnittswerten, ist hier jedoch gewissen Vorsicht geboten. Es mag vielleicht stimmen, dass rot die Farbe der Liebe ist und ein rotes Kleid im Schnitt zu höherem Erfolg im Dating führen mag [7]. Die ganze Arbeit kann das Kleid aber leider nicht übernehmen. Wenn man jemanden nicht leiden kann, dann wird auch ein noch so rotes Outfit nicht darüber hinweghelfen. Rotes Kleid gleich intimeres Kennenlernen ist möglicherweise richtig, wenn man sich den Erfolg von tausenden von Dates anschaut, aber nicht im Einzelfall.
Genauso gibt es viele intelligente Menschen mit kleinen Gehirnen und genauso viele minderbemittelte mit großen Gehirnen. Das liegt unter anderem daran, dass das Gehirn mit unserem Körper wächst. Große Menschen haben oft auch größere Gehirne, kleine Menschen haben kleine Gehirne. Aber ihre Intelligenz lässt sich davon nicht ableiten. Und obwohl Männer und Frauen im Schnitt gleich gut in Intelligenztests abschneiden, so haben Männer etwas mehr Hirn im Kopf. Einstein kann also beruhigt sein, das Gewicht seines Gehirns lässt kein Urteil über sein Denkvermögen zu.[5]
Autopsie wie aus einem Horrorfilm
Was macht nun Thomas Harvey, der Autopisearzt von Albert Einstein, nachdem er festgestellt hat, dass der Physiker tatsächlich ein Gehirn hat und dass dieses Gehirn auf den ersten Blick normal aussieht? Er könnte es in den Körper des Verstorbenen zurücklegen, denn Einstein hatte sich gewünscht verbrannt und dann an einem unbekannten Ort verstreut zu werden. Er wollte, dass bloß niemand auf die Idee kommt, an sein Grab zu Pilgern. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er wie ein Superstar verehrt und dass obwohl die meisten Leute gar nicht verstanden haben, was genau seine Theorien zu bedeuten haben. So hat er unter anderem Fanpost aus dem Gefängnis erhalten und wurde in langen Briefen nach Ehetipps gefragt. Wenigstens im Nachleben wollte der Physiker Ruhe von dem Promileben haben.[1]
Harvey ist das Egal. Wenn am Ende sowieso nur Asche übrig ist, wer würde dann merken, ob ein paar Flocken verbranntes Gehirn fehlen? Er behält das Organ erstmal für sich. Den Körper macht er wieder zu, als wäre nie etwas geschehen. [1]
Wow, ganz schön schrecklich was der Doktor da veranstaltet hat! Viel schlimmer hätte es Einstein ja fast nicht treffen können. Fast! Denn Thomas Harvey ist nicht der einzige, der am Ende dieses Tags mehr Organe hat als vorher. Sein Kollege Henry Abrams kann auch seine Finger nicht bei sich lassen. Bevor die sterblichen Überreste des einstigen Genies in Rauch aufgehen, nimmt er der Leiche noch die Augen heraus. Mit bloßen Fingern! Als Erinnerung an einen guten Freund, wie er später sagen wird. Der Familie des Dahingeschiedenen erzählt niemand von diesen Geschehnissen. Aber wie das nun mal so ist, kann man große Geheimnisse einfach nicht bei sich behalten. Schon am nächsten Morgen wird der Sohn von Thomas Harvey in der Schule erzählen, dass sein Papa das Gehirn von Albert Einstein gemopst hat. Und von da war der Weg zur Presse nicht mehr weit. [1]
Ein langer Weg zum Erfolg
Was macht man nun, dass man öffentlich dabei erwischt wurde, wie man einem toten das Gehirn gestohlen hat? Thomas Harvey geht in die Offensive. Irgendwie schafft er es Einstein’s Sohn davon zu überzeugen, dass der Diebstahl gar nicht so schlimm war wie er aussieht. Eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen, aber am Ende des Gesprächs ist der Sohn so in den Bann des Doktors gezogen, dass er ihn beauftragt, das Gehirn noch ein bisschen zu Untersuchen. Was ist schon dabei? Und der mögliche Fortschritt den solche Untersuchungen der Wissenschaft bringen können ist ja unbestreitbar.[1]
Harvey macht sich also an die Sache. Zuerst präserviert er das Gehirn, dann zerstückelt er es und schließlich verschickt er einzelne Teile an Hirnforscher im ganzen Land. So reist Einstein’s Gehirn mehr, als er es selbst je getan hat. Das allgemeine Interesse an den Stücken ist allerdings gering. Viele der Wissenschaftler, die zum Teil ungefragt Gehirnschnipsel von Harvey zugeschickt bekommen, melden sich nie mehr zurück. Sie haben nichts Interessantes gefunden, oder fanden einfach ausreichend Genugtuung darin, das Gehirn des legendären Wissenschaftlers einfach anzuschauen. [1]
Ganze 30 Jahre ziehen ins Land bis ein erstes Ergebnis der Untersuchungen veröffentlicht wird. Es wird festgestellt, dass er mehr Gliazellen als normale Menschen haben soll [8]. Das sind Helferzellen im Gehirn, die unter anderem für die Nährstoffzufuhr verantwortlich sind. Außerdem hatte Einstein eine besonders lange Furche im hinteren Bereich seines Hirns und eine andere Stelle ist außergewöhnlich groß [9]. Ist das, warum Einstein so schlau war?
Eine Geschichte vom Scheitern
Wahrscheinlich nicht. Zum einen ist es schon umstritten, ob die erwähnten Unterschiede im Gehirn des Nobelpreisträgers wirklich so außergewöhnlich sind. Unsere Gehirne sind so einzigartig wie es zum Beispiel unsere Gesichter auch sind. Zwar gibt es einige Merkmale, die immer ungefähr gleich bleiben, so wie fast jeder auch einen Mund, zwei Augen und eine Nase hat. Aber darüber hinaus hat jedes Gehirn seine eigenen spezifischen Merkmale und Eigenarten. Also, selbst wenn man ein Allerweltsgehirn von einer Durchschnittsperson mit anderen vergleicht, wird man Unterschiede feststellen können. [10]
Viel wichtiger aber, es ist überhaupt nicht klar, ob und wie diese Merkmale sich in messbare Eigenschaften wie Intelligenz übertragen lassen. Zum Beispiel könnten die Unterschiede, die in Einsteins Gehirn gefunden wurden, ja auch mit enormer Kreativität oder seinem berühmten Humor zusammenhängen. Der Versuch, in einem einzigen Gehirn die Quelle von mentaler Größe zu finden, hatte also von Anfang schlechte Erfolgsaussichten [10].
Thomas Harvey behielt Stücke von Einsteins Gehirn bis zu seinem Tod. Also den Teil, den er nicht im Laufe seines Lebens freimütig an diverse Forschende und Freunde vergeben hat. Heute kann man sich diese verbleibenden Stücke im Nationalen Museum für Gesundheit und Medizin in Maryland in den USA anschauen. Für eine Zeit waren sie sogar für Schnäpchenhafte $0,99 im App Store zu haben [11].
Einsteins Wunsch eingeäschert und verstreut zu werden scheint bis auf weiteres unerfüllt zu bleiben. Zumindest in Teilen.
Quellen
[1] Carolyn Abraham. (2001). Possessing Genius; The Bizarre Odyssey of Einstein’s Brain. Icon Books.
https://www.goodreads.com/book/show/359852.Possessing_Genius
[2] Huschke, E. (1854). Schaedel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere nach Alter, Geschlecht und Raçe : nebst sechs Steintafeln mit photographischen Abbildungen dargestellt. Friedrich Mauke. https://archive.org/details/BIUSante_01864/page/n139/mode/2up
[3] Gould, S. J. (1996). The Mismeasure of Man. WW Norton & Co. http://tankona.free.fr/gould1981.pdf
[4] Beals, K. L., Smith, C. L., Dodd, S. M., Angel, J. L., Armstrong, E., Blumenberg, B., Girgis, F. G., Turkel, S., Gibson, K. R., Henneberg, M., Menk, R., Morimoto, I., Sokal, R. R., & Trinkaus, E. (1984). Brain Size, Cranial Morphology, Climate, and Time Machines. 25(3), 301–330. https://doi.org/10.1086/203138
[5] Hartmann, P., Ramseier, A., Gudat, F., Mihatsch, M. J., Polasek, W., & Geisenhoff, C. (1994). Das Normgewicht des Gehirns beim Erwachsenen in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht. Der Pathologe, 15(3), 165–170. https://doi.org/10.1007/S002920050040
[6] Deary, I. J., Penke, L., & Johnson, W. (2010). The neuroscience of human intelligence differences. In Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nrn2793
[7] Johnson, K. K. P., Lennon, S. J., & Rudd, N. A. (2014). Dress, body and self: research in the social psychology of dress. Fashion and Textiles, 1(1). https://doi.org/10.1186/s40691-014-0020-7
[8] Diamond, M. C., Scheibel, A. B., Murphy, G. M., & Harvey, T. (1985). On the brain of a scientist: Albert Einstein. Experimental Neurology, 88(1), 198–204. https://doi.org/10.1016/0014-4886(85)90123-2
[9] Witelson, S. F., Kigar, D. L., & Harvey, T. (1999). The exceptional brain of Albert Einstein. The Lancet, 353(9170), 2149–2153. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(98)10327-6
[10] Hines, T. (2014). Neuromythology of Einstein’s brain. Brain and Cognition, 88, 21–25. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2014.04.004
[11] AppAdvice (2019, October 5). Einstein Brain Atlas by National Museum of Health + Medicine Chicago. AppAdvice. https://appadvice.com/app/einstein-brain-atlas/555722456