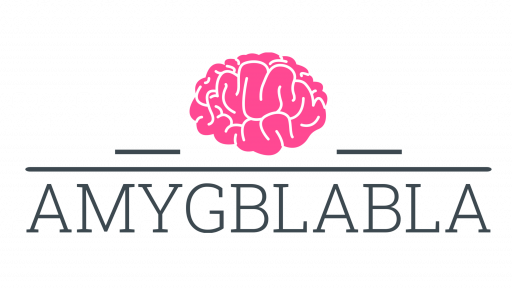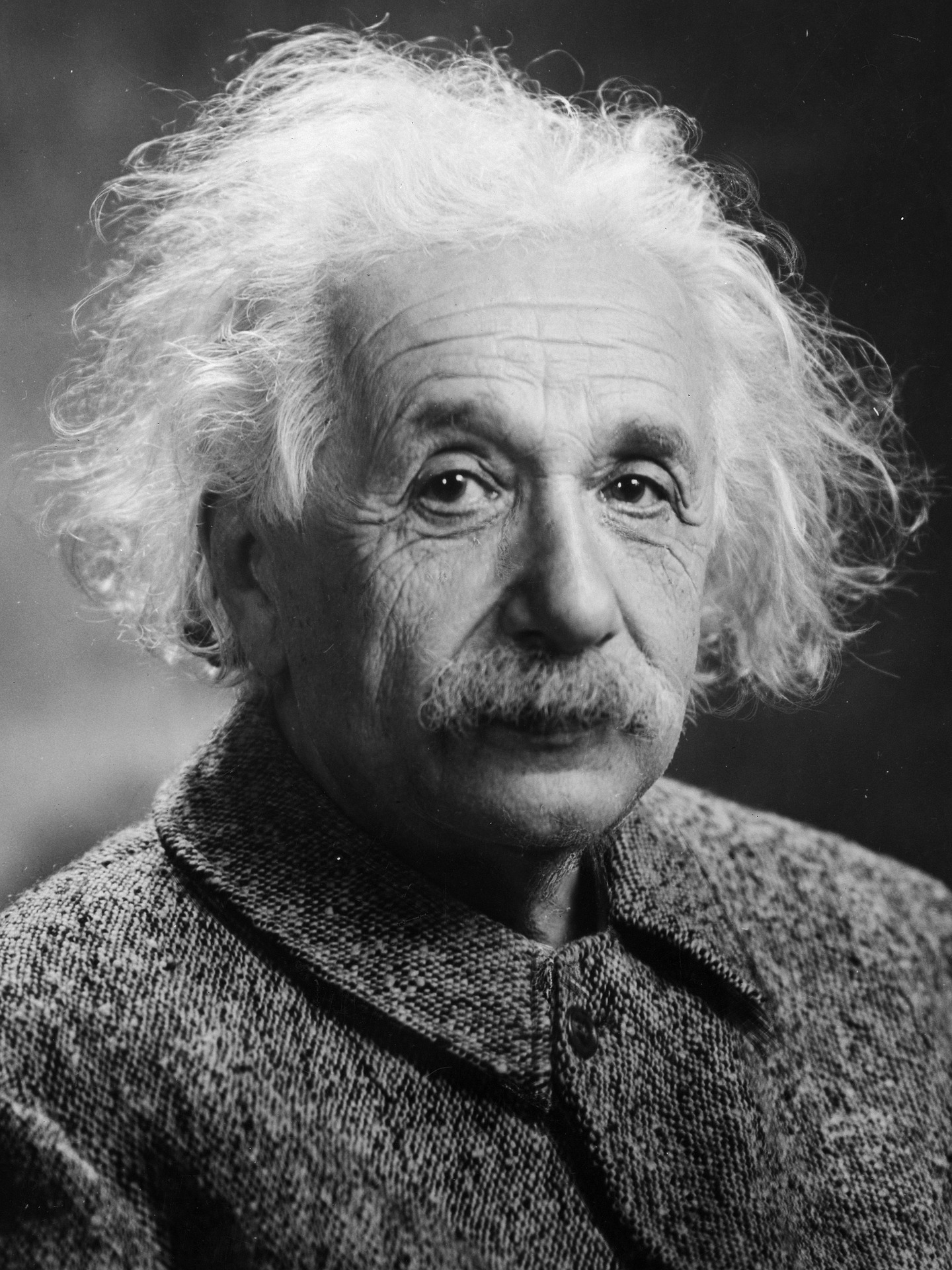Alles ist doof… Mal wieder!
Warum ist eigentlich die Frau vor mir an der Kasse so langsam, mein Fahrradreifen immer noch kaputt, der letzte Urlaub zu lange her, und dann macht sich auch noch die Klimakrise mal wieder mit schlechtem Wetter bemerkbar? Wie soll man da sein Glück finden?
Man hat schon einen erstaunlichen Fokus auf das schlechte. Der Durchschnittsmensch ist quasi besessen davon. Zeitungen verkaufen sich besser, wenn sie unerfreuliches berichten [1] und obwohl man dramatisch leidet, wenn man sich den Zeh an der Tür stößt, so ist man nie glücklich, wenn man an einer Tür heil vorbeigekommen ist.
Ein anderes Beispiel: Die Sicht einer Kakerlake in der Küche eines 5-Sterne-Restaurants kann einem das vorzüglichste Essen vermiesen, aber schmackhaftes Essen zu sehen, hat noch niemanden dazu verleitet, Kakerlaken zu verspeisen.
Negativität kann man schon im Gehirn messen
Aber nicht nur in der Küchenpsychologie, sondern auch in der Wissenschaft kennt man dieses Phänomen. Probanden lernen besser, wenn man ihre Fehler bestraft, anstatt ihre Erfolge zu loben. Wenn man Studienteilnehmenden drei positive und drei negative Aspekte über eine andere Person verrät, so haben sie am Ende kein neutrales Bild von der Person, sondern ein schlechtes. [2]
Und auch im Gehirn kann man die Fokussierung auf schlechtes messen. Dazu setzen Forschende sehr sensitive Elektroden auf den Kopf von Studienteilnehmenden und messen die Gehirnaktivität, die sich unter der Schädeldecke abspielt. Elektroenzephalographie (EEG) nennt sich das. Es funktioniert, weil die Elektrizität, mit der unsere Neuronen kommunizieren, in ganz kleinem Umfang, auch durch den Schädelknochen und in die Haut weitergeleitet wird.
So haben Forschende herausgefunden, dass im Gehirn große Gruppen von Neuronen anfangen, simultan zu feuern, wenn man Probanden mit etwas Unerwartetem konfrontiert. Wird man von etwas Positivem überrascht, sind jedoch lange nicht so viele Neuronen beteiligt, wie bei etwas unerwartet Negativem. [3] Es scheint wirklich tief eingebrannte Mechanismen in uns zu geben, die uns immer nur das Schlechteste sehen lassen. Aber warum ist das so?
Ein Ausflug in die Vergangenheit des Menschen
Die Antwort findet man, wie bei so vielen Fragen, in der Biologie. Genauer, in der Evolutionstheorie. Wenn man dieser Theorie folgt, kann man zu dem Schluss kommen, dass Unzufriedenheit einer der Gründe ist, warum wir es als Menschen so weit geschafft haben. „Kann“ ist ein wichtiges Wort hier, denn es ist quasi unmöglich zweifelsfrei zu beweisen, dass eine bestimmte Eigenschaft sich auf eine bestimmte Weise entwickelt hat. Aber es macht trotzdem Sinn, sich einmal Gedanken dazu zu machen, welche Vorteile unsere Negativitätsbesessenheit gehabt haben könnte. [3]
Also ein Gedankenexperiment: Huwulu und Mirini sind zwei Brüder, die zu der Zeit unserer Vorfahren gelebt haben. Huwulu ist durch und durch zufrieden. Er strebt weder Ruhm noch Reichtum noch irgendetwas sonst an. Er ist einfach zufrieden mit dem, was er hat. Im Laufe seines außergewöhnlich glücklichen Lebens findet er eine Frau, die genauso zufrieden ist wie er, und wird alt mit ihr. Zusammen kriegen sie ein paar Kinder und kümmern sich mit bewundernswerter Hingabe und Liebe um sie. Auch die Kinder könnten nicht anspruchsloser und lebensfroher sein. Huwulu begründet eine beschauliche Familie, die zwar einfach lebt, aber sorgenfrei und beglückt ihre Tage gestaltet.
Der Steinzeit-Grinch
Mirini hingegen ist äußerst unzufrieden. Ihm könnte man das beste Essen auf der Welt geben, die tollsten Kinder, den liebenswertesten Partner und ihn dazu noch zum König krönen, er hätte immer noch nicht genug. Seine Biografie ist folglich ganz anders als die von Huwulu. Er reist von Ort zu Ort, und findet immer den am hässlichsten, an dem er sich gerade befindet. Er hat viele verschiedene Beziehungen zu vielen verschiedenen Frauen, denn sie sind immer nur dann interessant für ihn, wenn er sie nicht haben kann.
Sobald er mehr als ein halbes Jahr mit ihnen verbringt, stehen sie ihm bis zum Hals mit ihrer nervtötenden Art. Er entflieht seinem unerträglichen Leben und läuft direkt in die Arme des nächsten Unglücks. Im Laufe seines Lebens reißt Mirini alles an sich und stellt dann doch wieder fest, dass es nicht genug ist. Nie hält er auch nur einen einzigen Moment an, um dankbar zu sein für das, was er bereits hat. In seinem umtriebigen Leben hat er nur wenige glückliche Tage und stirbt irgendwann einsam und verbittert.
Wer ist der Held?
Wären wir hier in einem Disneyfilm, wäre der glückliche und bescheidenen Huwulu der Sympathieträger der Geschichte. Das ist der Evolution nur leider egal, sie misst Heldentum mit anderen Maßstäben. Für sie ist der ewig verdrossene Mirini der eindeutige Gewinner. Die Geschichte hat nämlich zwei Haken:
Zum einen hat Huwulu’s chronische Freude ihn zum Ziel verheerender Schicksalsschläge gemacht. Dadurch, dass er nie auch nur einen einzigen schlechten Gedanken hat, fehlt ihm auch jede Vorsicht, jedes Misstrauen und jeder Wille zur Veränderung.
Würde er zum Beispiel immer wieder von einem befeindeten Familienclan attackiert, hätte er nicht die Empörung und Wut, die ihm helfen würden mit der Situation umzugehen.
Während all seine Nachbarn irgendwann zu viel haben und in sicherere Gegenden ziehen, gibt er sich mit der Lage zufrieden. Er braucht ja sowieso nicht so viel und wenn es die anderen glücklicher macht, dann sollen Sie seine hart erarbeitete Ernte ruhig wegnehmen. Das ist zwar sehr nett von ihm, aber seine ganze – immer noch sehr glückliche – Familie fristet dann ein Leben in bitterer Armut. Weil alle seine Kinder genauso sind wie er, ist seine gesamte Nachkommenschaft nach ein paar Generationen verhungert. Sie alle waren sehr glücklich, aber jetzt gibt es sie leider nicht mehr.
Der andere Haken ist, dass Mirini’s Umtriebigkeit den unabsichtlichen Effekt hatte, dass er Vater von sehr vielen Kindern geworden ist. Diese Kinder haben die unterschiedlichsten Eigenschaften von ihrer jeweiligen Mutter geerbt. Eines haben sie aber alle gemein: Sie sind verbittert und unzufrieden, so wie ihr Vater, denn sie haben seine Gene und mussten ohne seine Liebe aufwachsen. Er war ja schon wieder bei einer neuen Freundin.
Das hat nun eigentümliche Konsequenzen. Während Huwulu’s Kinder langsam, aber glücklich verhungern, schreiten die Kinder Mirini’s mit der Umtriebigkeit ihres Vaters durch die Welt. Auch sie reißen alles an sich, was sie sehen, haben viele verschiedene Kinder mit vielen verschiedenen Partnern und sterben irgendwann einsam und verbittert. Und während die Nachfahren Huwulu’s immer weniger werden, haben Mirini’s nach ein paar Generationen mit ihrer Rastlosigkeit die Welt bevölkert. Sie sind die eindeutigen Gewinner im großen Spiel der Evolution.
Ohne schlechte Laune gäbe es uns nicht
Natürlich sind sowohl die Mirinis als auch die Huwulus sehr extrem in ihrem Verhalten. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen von beiden in uns. Aber ohne den unglücklichen Mirini wären die Menschen nicht besonders weit gekommen. Viel Aufmerksamkeit auf Schlechtes zu richten ist so wichtig in der Evolution, dass es auch im Tierreich weit verbreitet ist. Obwohl man Tieren einfach den Appetit auf etwas verderben kann, dass sie eigentlich mögen, ist es fast unmöglich ihnen etwas unappetitliches schmackhaft zu machen. Und auch sie merken sich Strafen besser als Belohnungen. [4]
Vielleicht macht es dich jetzt glücklicher zu wissen, wo deine Unzufriedenheit herkommt. Aller Wahrscheinlichkeit nach tut es das aber nicht, denn du bist und bleibst eben ein Mirini. Ich werde immer noch schlecht gelaunt in den Tag starten, wenn mein Kaffee mal wieder die falsche Temperatur hat und mich nie freuen, wenn er einmal genau richtig ist. Aber nun werde ich es mit dem Wissen tun, dass es meine Unzufriedenheit ist, die mir meinen Platz auf dieser Erde verschafft hat. Und wenn ich mir oft genug den Mund am Kaffee verbrenne, habe ich vielleicht doch noch Chancen ein übellauniger, aber reicher Manager zu werden. Ein Hoch auf die Unzufriedenheit!
Quellen
[1] Arango-Kure, M., Garz, M., & Rott, A. (2014). Bad News Sells: The Demand for News Magazines and the Tone of Their Covers. Journal of Media Economics, 27(4), 199–214. https://doi.org/10.1080/08997764.2014.963230
[2] Hodges, B. H. (1974). Effect of valence on relative weighting in impression formation. Journal of Personality and Social Psychology, 30(3), 378–381. https://doi.org/10.1037/h0036890
[3] Norris, C. J. (2019). The negativity bias, revisited: Evidence from neuroscience measures and an individual differences approach. Social Neuroscience, 16(1), 68–82. https://doi.org/10.1080/17470919.2019.1696225
[4] Rozin, P., & Royzman, E. B. (2001). Negativity Bias, Negativity Dominance, and Contagion. Personality and Social Psychology Review, 5(4), 296–320. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0504_2