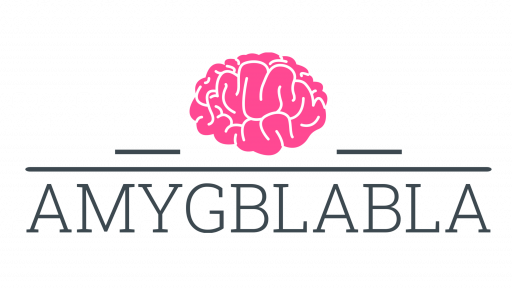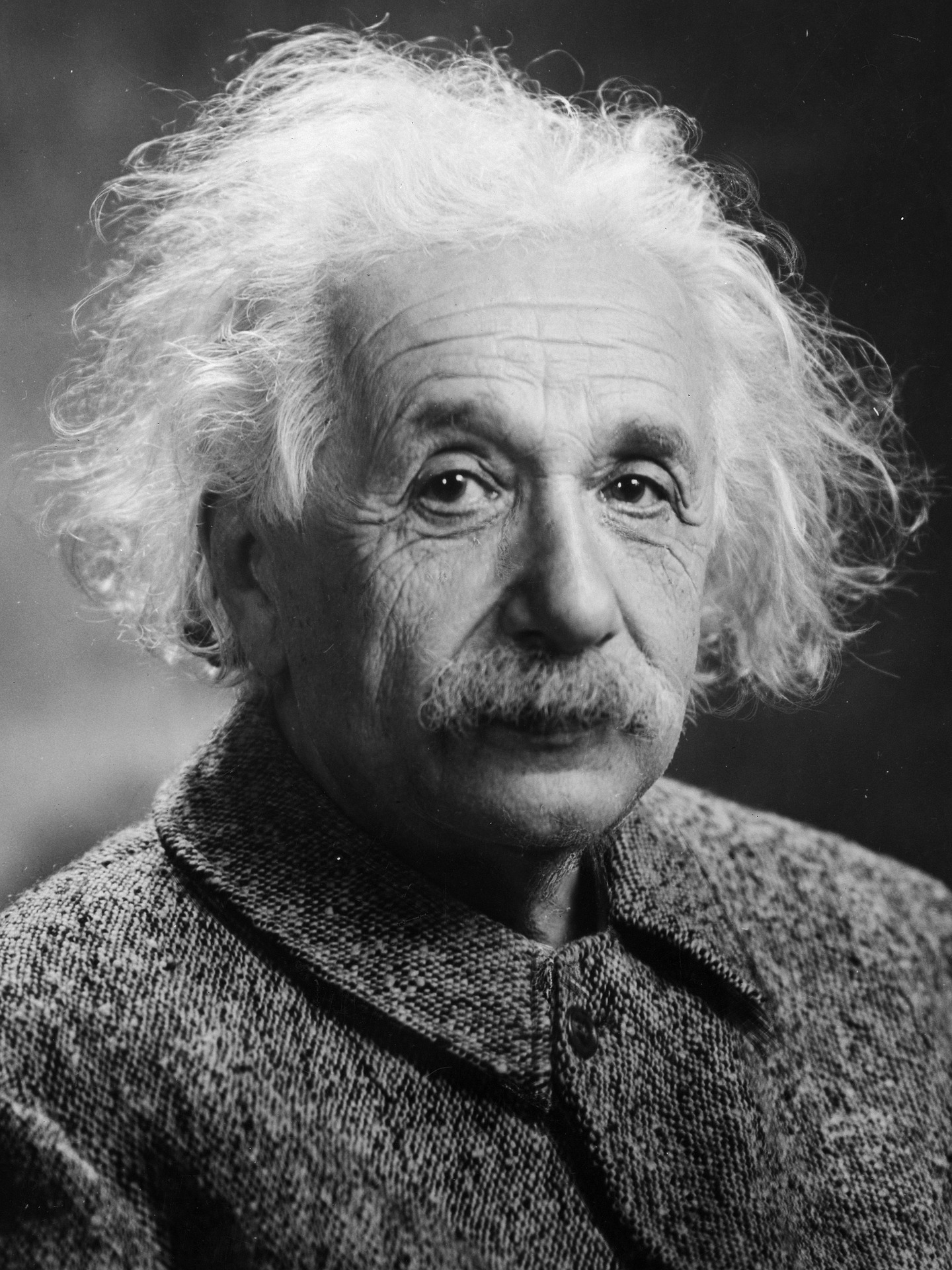Über 100 Jahre Forschung
Wie sieht wohl eine Erinnerung aus? Bereits seit über 100 Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft mit dieser Frage. Man möchte eine Erinnerung zum Anfassen haben, eine, die man in die Luft werfen und wieder auffangen kann, die man in Privaten Momenten auch mal der besten Freundin zeigen kann. Dieser Art von Erinnerung hat man auch einen Namen gegeben: das Engramm, also die physische Manifestation der Erinnerung. Trotz anfänglicher Rückschläge ist man diesem Engramm inzwischen dicht auf der Spur. [1]
Erinnerungsjäger mit Skalpell
Einer der ersten, die das Engramm als Ziel erklärt hatten, war Karl Lashley. Mitte des 20ten Jahrhunderts hat er in einem über 30 Jahre dauerndem Forschungsmarathon die Gehirne von Ratten systematisch untersucht.[1]
Dazu hat er ihnen erst beigebracht, sich in einem Labyrinth zurechtzufinden und ihnen dann systematisch immer einen anderen Teil des Gehirns entfernt. Wenn sich nach einem der Eingriffe die Ratte nicht mehr orientieren kann, dann muss er den Ort herausgeschnitten haben, an dem sich das Engramm verbirgt.[1]
Bei seinen Experimenten hat er sich vor allem auf die Großhirnrinde konzentriert, also die äußerste Schicht des Gehirns, die mit komplexeren Funktionen wie Denken oder dem Verarbeiten von Umweltreizen in Verbindung gebracht wird. Nach ausgiebigen Versuchen kommt Lashley zu einem erstaunlichen Ergebnis. Egal welchen einzelnen Teil der Hirnrinde er entfernt, die Ratten können weiterhin fehlerfrei navigieren. Erst wenn er fast alles auf einmal wegschneidet, wird das Gedächtnis der Ratten schlechter. Am Ende entzieht sich das Engramm also Lashley’s Skalpell, es ist ihm nicht möglich eine einzelne Region einzukreisen, in der die Erinnerung sich befindet.[1]
Wo ist die Erinnerung?
Kann man also Erinnerungen gar nicht im Gehirn finden? Kann man schon, aber Lashley hat falsch gesucht. Heute wissen wir, dass ein Engramm nicht an einem einzelnen Ort, sondern an vielen verschiedenen Stellen im Gehirn gespeichert wird. Forschende gehen davon aus, dass Erinnerungen in ihre verschiedenen Aspekte aufgespalten werden. Der visuelle Teil einer Erinnerung wird im visuellen Teil des Gehirns gespeichert, der emotionale Teil wird im Emotionszentrum gespeichert und so weiter.[2]
Es gibt zwar Strukturen, die wichtiger sind als andere, wenn es darum geht sich an etwas zu erinnern, aber die liegen tief im Inneren des Gehirns, nicht in der Großhirnrinde, also weit weg von der Stelle, an der Lashley gesucht hat.[2]
In den nächsten Jahrzehnten nach seinen Experimenten ist die Forschung dem Engramm immer ein Stück nähergekommen ist, ohne es jedoch ganz fassen zu können. Man hatte inzwischen eine recht gute Idee, in welchen Bereichen Erinnerungen generell gespeichert werden, aber den genauen Ort für eine einzelne Erinnerung auszumachen war immer noch Zukunftsmusik. [1]
Denkende Zellen
In den 2000er Jahren ändert sich das gewaltig. Der gigantische Fortschritt der Gentechnik in den letzten Jahren eröffnete neue Möglichkeiten für viele Forschende. Einer davon war Mark Mayford an der Universität von Kalifornien. Er leitete dort Forschungsprojekt, dass es sich zum Ziel gesetzt hatte, eine Erinnerung nicht nur in einem bestimmten Bereich des Gehirns, sondern in den Neuronen zu finden.[3]
Neuronen sind die Zellen unseres Gehirns, die dafür verantwortlich sind, Informationen zu verarbeiten. Wenn unser Gehirn ein Buch wäre, dann wären Neuronen die Buchstaben. Durch ihr perfekt abgestimmtes Zusammenspiel können wir sprechen, tanzen, Ikeaschränke aufbauen und uns eben an Ereignisse erinnern. Obwohl es schon sehr lang bekannt ist, dass Neuronen das können, war es nie sicher, und ist es eigentlich bis heute nicht so ganz, wie sie das Fertigbringen. Denn es gibt unzählige von ihnen, die alle gleichzeitig und durcheinander die verschiedensten Aufgaben erledigen. [2]
Wenn man ein menschliches Haar nimmt, es der Länge nach halbiert, die Hälfte davon wieder halbiert und dann noch einmal die Hälfte halbiert, ist man ungefähr in der Größenordnung von Neuronen.[2] Und von diesen winzigen Zellen gibt es 86 Milliarden Stück [4]. Jeder von uns besitzt also mehr als zehnmal so viele Neuronen, wie es Menschen auf der Erde gibt. In diesem Dschungel aus Zellen gilt es diejenigen zu finden, die zu einer bestimmten Erinnerung gehören. Die Nadel im Heuhaufen wäre deutlich einfacher zu finden.
Erinnerungen aus dem Labor
Bevor sich Mayford’s Team dieser Hürde widmen konnte, mussten sie erstmal Erinnerungen herstellen. Am besten solche, die man gut nachverfolgen kann, also genau weiß wann sie entsteht und wann sie wieder abgerufen wird. Zu diesem Zweck hat man ein paar Mäuse genommen, sie einzeln in eine kleine Box getan und dann den Elektroschocker angestellt. Nach diesem erinnerungswürdigen Event, wurden die Mäuse für drei Tage in Ruhe gelassen und dann wieder in dieselbe Box gestellt, ohne dass diesmal der Strom angestellt wird. Vorherige Forschung hatte gezeigt, dass sich die Mäuse Angsterfüllt an die letzte Begegnung mit der Box erinnern. [3]
Der genetische Pinsel
Um nun diese Erinnerung in dem Chaos von Neuronen wiederzufinden, haben Mark Mayford und seine Kollegen auf eine der vielversprechendsten Methoden der letzten Jahre zurückgegriffen: Die Gentechnik. Es ist inzwischen möglich die Gene von Lebewesen nach Belieben zu verändern: Man kann Mäuse im Dunkeln leuchten lassen, Hühnern die Flügel vergrößern, oder Bananen vor Hepatitis B impfen. [5, 8].
Das Team von Mark Mayford hat diese Technik dazu benutzt, einzelne Neuronen der Mäuse grün einzufärben. Der besondere Trick dabei war, dass nur die Neuronen die Farbe verändern, die kurz zuvor aktiv waren. Wenn man die Färbung also kurz nach dem traumatischen Vorfall in der Box vornimmt, dann leuchten die dabei beteiligten Neuronen jetzt grün. [3]
Damit ist es aber noch nicht getan. Im Gehirn sind ständig alle möglichen Neuronen aktiv. Manche sagen der Maus etwas darüber, wo sie sich gerade befindet, manche sorgen dafür, dass sich ihre Körperteile koordiniert bewegen und andere sind einfach so aktiv, ohne dass sie irgendetwas Bestimmtes bewirken. Um jetzt herauszufinden, welche davon zu der Erinnerung gehören, hat Mayfords Team zu einem weiteren genetischen Pinsel gegriffen, nachdem die Maus das zweite Mal in die Box gestellt wurde. Die nun aktiven Neurone wurden rot eingefärbt.[3]
Wenn nun eine Zelle zu beiden Zeitpunkten aktiv ist, also sowohl beim Lernen als auch beim Erinnern, ist es wahrscheinlich, dass sie zu der spezifischen Erinnerung gehören. Unter dem Mikroskop sehen diese Zellen, die sowohl mit dem roten als auch mit dem grünen Pinsel angemalt wurden, aus, wie kleine gelbe Flammen auf schwarzem Grund.[3]
Fühlt sich eine Erinnerung an wie Wackelpudding?
Sehen so also Erinnerungen aus? Wie kleine gelbe Flammen? Oder haben sie dann doch eher normale Farbe des Gehirns, also fleischig beige. Und kann sie anfassen? Die Neuronen im Gehirn kann man auf jeden Fall anfassen, sie fühlen sich weich und schleimig an, ein bisschen so an wie Wackelpudding.[2]
Aber ganz so einfach ist es am Ende doch nicht. Viele Forschende gehen heute davon aus, dass Erinnerungen nicht wirklich in Neuronen gespeichert werden, sondern in den Synapsen. Das sind die Verbindungspunkte zwischen Neuronen, die festlegen können, welche Neuronen Teil des Engramms werden und wie stark einzelne Aspekte zu der ganzen Erinnerung beitragen. Stellt man sich Neurone als einzelne Räume in einem großen Haus vor, dann sind wären Synapsen die Türen. [6,7]
Ist die Tür zwischen zwei Neuronen offen, dann gehören sie zu demselben Engramm, ansonsten nicht. Man bräuchte also einige Fingerfertigkeit, um die Nanometer großen Übergänge spezifisch anzufassen. Und von der bloßen Berührung wüsste man noch nicht, worum es in der Erinnerung geht.
Das sehr viel größere Problem ist aber eigentlich, dass niemand genau weiß, wie Neurone überhaupt die farbenfrohen Bilder in unseren Köpfen erzeugen. Als „das schwierige Problem“ wird dieser Umstand oft beschrieben. Ob die Erinnerung also wirklich im Gehirn ist, oder nur in unserer Vorstellung, darüber zerbrechen sich Philosophen noch immer die Köpfe. [9]
Die Wissenschaft hat also ihr heiß ersehntes Engramm nicht gefangen, obwohl sie ihm dicht auf den Fersen ist. Manche bezweifeln sogar, ob man es je ganz fangen kann. Bis dahin gehören unsere Erinnerungen ganz allein uns, niemand kann sie wegnehmen.
„Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten,
sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen,
es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei.”
–Deutsches Volkslied
Quellen
[1] Josselyn, S. A., & Tonegawa, S. (2020). Memory engrams: Recalling the past and imagining the future. Science, 367(6473). https://doi.org/10.1126/science.aaw4325
[2] Breedlove, S. M., & Watson, N. V. (2019). Behavioral Neuroscience. Sinauer Associates, Incorporated.
[3] Reijmers, L. G., Perkins, B. D., Matsuo, N., & Mayford, M. (2007). Localization of a Stable Neural Correlate of Associative Memory. Science, 317(5842), 1230–1233. https://doi.org/10.1126/science.1143839
[4] Azevedo, F. a. C., Carvalho, L. R., Grinberg, L. T., Farfel, J. M., Ferretti, R. E., Leite, R. E. P., Greve, J. M. D., Lent, R., & Herculano-Houzel, S. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. Journal of Comparative Neurology, 513(5), 532–541. https://doi.org/10.1002/cne.21974
[5] Matthaei, K. I. (2007). Genetically manipulated mice: a powerful tool with unsuspected caveats. The Journal of Physiology, 582(2), 481–488. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2007.134908
[6] Gidon, A., Aru, J., & Larkum, M. E. (2022). Does brain activity cause consciousness? A thought experiment. PLOS Biology, 20(6), e3001651. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001651
[7] Neves, G., Cooke, S. F., & Bliss, T. V. P. (2008). Synaptic plasticity, memory and the hippocampus: a neural network approach to causality. Nature Reviews Neuroscience, 9(1), 65–75. https://doi.org/10.1038/nrn2303
[8] Kumar, G. B. S., Ganapathi, T. R., Revathi, C. J., Srinivas, L., & Bapat, V. A. (2005). Expression of hepatitis B surface antigen in transgenic banana plants. Planta, 222(3), 484–493. https://doi.org/10.1007/s00425-005-1556-y
[9] Chalmers, D., J. (n.d.). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies.